
Sprachtherapie beinhaltet die Untersuchung und Behandlung von Sprach- und Sprechstörungen unterschiedlicher Ursachen
Leidensweg
Oft sehen und hören wir von Menschen, die lispeln oder stottern.
Aber was geschieht, wenn ein Kind nicht zu sprechen beginnt?
Wenn Kinder, die Worte im Satz nicht richtig ordnen können oder so undeutlich sprechen, dass sie im Kindergarten keinen Anschluss bekommen?
Was ist mit Kindern, die mündliche Aufforderungen nicht verstehen oder nicht die richtigen Worte parat haben, wenn sie von einem Erlebnis erzählen möchten? Wann sollte man als Eltern professionelle Hilfe in Anspruch nehmen?
Diese Fragen und viele weitere werden in der Sprachtherapie beantwortet.
Darüber hinaus kümmern sich Sprachtherapeuten aber auch um Erwachsene, die aus unterschiedlichen Gründen, Probleme mit der Stimme, dem Sprechen und der Sprache haben. Hierzu zählen Menschen, die aufgrund einer heiseren Stimme, Probleme haben, ihren Alltag zu bewältigen oder Menschen, die einen Schlaganfall hatten und sich daher mit Wortfindungsschwierigkeiten abmühen müssen oder eine verwaschene Aussprache haben.
Zu Beginn der Therapie steht immer eine ausführliche Diagnostik. Diese beinhaltet ein ausführliches Anamnesegespräch, sowie eine genaue Befunderhebung mittels standardisierter und informeller Testverfahren, die auch das soziale Umfeld des Patienten, sowie seine eigenen Vorstellungen und Ziele mitberücksichtigt. Auf der Basis dieser Ergebnisse, zusammen mit dem ärztlichen Befund wird dann ein individuelles Therapiekonzept erstellt.
Störungsbilder
Hier können wir helfen:

Sprachentwicklungsstörungen
jegliche Form der sprachlichen Beeinträchtigung oder Verzögerung, die eine regelrecht verlaufende kindliche Sprachentwicklung erschwert. Betroffen sein können: Artikulation, Grammatik, Wortschatz, Sprach- und Aufgabenverständnis, Sprachverarbeitung und -wahrnehmung, mundmotorische Fähigkeiten.
Aussprachestörung
Man unterscheidet hierbei phonetische und phonologische Störungen.
Eine phonetische Aussprachestörung liegt vor, wenn ein Kind es aus sprechmotorischen Gründen noch nicht schafft,
einzelne Laute zu bilden.
Bekannt ist hier der „Sigmatismus“, die Fehlbildung des /s/-Lautes („Lispeln“).
Von einer phonologische Aussprachestörung spricht man, wenn ein Kind einen Laut artikulatorisch richtig bilden kann, diesen jedoch im Wort nicht korrekt anwenden kann.
Es kommt z.B. zu Lautauslassungen und Lautvertauschungen.
Ursachen für Phonologische Aussprachestörungen können sein:
eine genetische Prädisposition, auditive Verarbeitungsstörungen, expressive Sprachstörungen, Umgebungseinflüsse, neurologische Entwicklungsstörungen etc.
Verbale Entwicklungsdyspraxie (VED)
hierbei handelt es sich um eine Entwicklungsstörung kindlichen Sprechens, die auch durch eine mangelhafte Aussprache gekennzeichnet ist.
Das zentrale Problem dieser Sprechstörung aberliegt bei der Sprechbewegungsplanung und -programmierung. Die Vielzahl der artikulatorisch notwendigen Sprechbewegungen, die notwendig sind, um ein Wort korrekt zu bilden kann nur unzureichend geplant und ausgeführt werden.
Die Sprache des Kindes ist dadurch kaum verständlich und die Lautbildungsfehler folgen keinem System.
Oft sind erste Anzeichen einer VED bereits im Säuglingsalter wahrnehmbar, z.B. durch:
– Probleme bei der Nahrungsaufnahme,
– grobmotorische Ungeschicklichkeiten,
– kaum produzierte Lall-Laute,
– eine oft verspätet beginnende Sprachentwicklung mit fehlenden Konsonanten und
Nutzung einer „Vokalsprache“.

Rhinophonie
das ‚Näseln‘, wie es im allgemeinen Sprachgebrauch genannt wird, entsteht durch einen unzureichenden Abschluss des Nasen- und Mundraums durch das Gaumensegel, wodurch beim Reden zu viel Luft durch Mund oder Nase entweicht. Der Klang der Stimme ist nasal (wie bei einem Dauerschnupfen), die Artikulation ist undeutlich und klingt verwaschen. Eine Rhinophonie kann organische oder funktionelle Ursachen haben.
Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung (AVWS)
bezeichnen Einschränkungen bei der Wahrnehmung und Verarbeitung von Gehörtem, die nicht in der Beeinträchtigung des ’normalen‘ (peripheren) Hörens liegen.
Kinder und Jugendliche mit dieser Störung haben Probleme, Gehörtes aufzunehmen, zu speichern und zu wiederholen. Es fällt ihnen schwer, Höreindrücke zu unterscheiden, wiederzuerkennen und auszuwerten.
Eine Auditive Wahrnehmungs- und Verarbeitungsstörung tritt oft in Verbindung mit einem Aufmerksamkeitsdefizit Syndrom (ADS) und der Lese-/Rechtschreibstörung auf.
Diese Auffälligkeiten können auftreten:
– das Kind wirkt abwesend und reagiert nicht oder sehr verzögert auf Ansprache,
– das Kind ist schon durch leise Geräusche ablenkbar und äußerst geräuschempfindlich,
– das Kind versteht komplexere Aufträge/Äußerungen nur verzögert oder unvollständig,
– das Kind wirkt oftmals unkonzentriert und unruhig,
– die Aussprache des Kindes ist unter Belastung eher verwaschen,
– das Kind hat erhebliche Probleme, sich Dinge zu merken.

Dysgrammatismus
bezeichnet eine Störung einer Teilleistung des kindlichen Spracherwerbs, der Grammatikentwicklung. Betroffen sind häufig: Pluralbildung, Verbstellung, Satzbildung und Verbbeugung. Häufig einhergehend mit dem Dysgrammatismus ist eine Ausdrucksschwäche, die sich darin äußert, dass komplexere Sachverhalte, Erlebnisse, Gefühle etc. nicht strukturiert oder verständlich erzählt werden können.
Myofunktionelle Störung
Es besteht eine Dysfunktion der Muskulatur im Mund- und Gesichtsbereich. Dieses Ungleichgewicht beeinträchtigt essentielle Funktionen, wie Sprechen, Schlucken und Atmen, was sich in den Unterschiedlichsten Symptomen äußern kann: Ausspracheprobleme vor allem bei Zischlauten (s, z, sch), falsches Schluckmuster, Zahnfehlstellungen, Mundatmung, schlaffe Muskelspannung im Gesicht, Auswirkungen auf die Körperhaltung, Spannungen im Nacken-Schulterbereich, Konzentrationsprobleme.
Da diese Dsyfunktion zahlreiche Auswirkungen auf die allgemeine Gesundheit haben kann, erfordert deren Behandlung oft eine multidisziplinäre Strategie, um sowohl die direkten als auch sekundäre Auswirkungen therapieren zu können.
Aphasie
bedeutet vom Ursprung her „ohne Sprache“ und wird als Sprachverlust nach einer neurologischen Erkrankung, z.B. Schlaganfall, Schädelhirntrauma, Gehirnentzündungen, Sauerstoffmangel etc. verstanden. Zum Sprachverlust kommt es aufgrund einer Beschädigung von bestimmten Regionen im Gehirn, die für die Steuerung der Sprache entscheidend sind.
Die Aphasie ist eine erworbene Sprachstörung nach Abschluss des Spracherwerbs und kann verschiedene sprachliche Bereiche betreffen: die gesprochene Sprache, das Sprachverstehen, aber auch das Lesen und Schreiben. Je nachdem, wie stark welche Hirnregion im Sprachnetzwerk betroffen ist unterscheidet man: Amnestische bzw. motorische Aphasie, Broca-Aphasie, Wernicke-Aphasie oder die Globale Aphasie.

Dysarthrie
ist eine neurologisch bedingte Sprechstörung, verursacht durch Beschädigungen der für die Sprechmotorik zuständigen Nerven- und/oder Muskelstrukturen, etwa aufgrund eines Schlaganfalls, einer Hirnhautentzündung, einer Parkinson-Erkrankung etc.
Beeinträchtigt sein können in unterschiedlich starker Ausprägung, die Sprechmotorik, das Kauen und Schlucken, die Sprechatmung, sowie die Mimik. Das Sprechen ist dadurch für den Patienten sehr anstrengend. Die Artikulation ist oft undeutlich, Sprechtempo und -melodie, Sprechatmung und die Stimmbildung können ebenso beeinträchtigt sein.
Dysphonie
bezeichnet eine Störung der Sprechstimme. Man unterscheidet die funktionelle Stimmstörung (-hier gibt es keine pathologischen Veränderungen am Kehlkopf) und die organische Stimmstörung (-hier sind pathologische Veränderungen am Kehlkopf nachweisbar: Entzündungen, Lähmungen, Gewebsneubildungen…). Grundlegend ist die Stimme hierbei in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt. Die Störungen der Stimme äußern sich z.B. in einem heiseren oder gepressten Stimmklang. Die Stimme kann nicht mehr variabel eingesetzt werden und ist beeinträchtigt oder verändert in Lautstärke, Klangfarbe, Tonhöhe oder Tonhaltedauer.
Ursachen einer funktionellen Stimmstörung liegen häufig in einem erhöhten Stimmdruck und einer länger andauernden Überbeanspruchung der Stimme, z.B. nach einer nicht auskurierten Erkältung oder bei psychosozialen Belastungen.
Organische Stimmstörungen entstehen z.B. durch Tumoren, Kehlkopffehlbildungen, hormonelle Erkrankungen, Stimmlippenlähmungen nach Operationen.
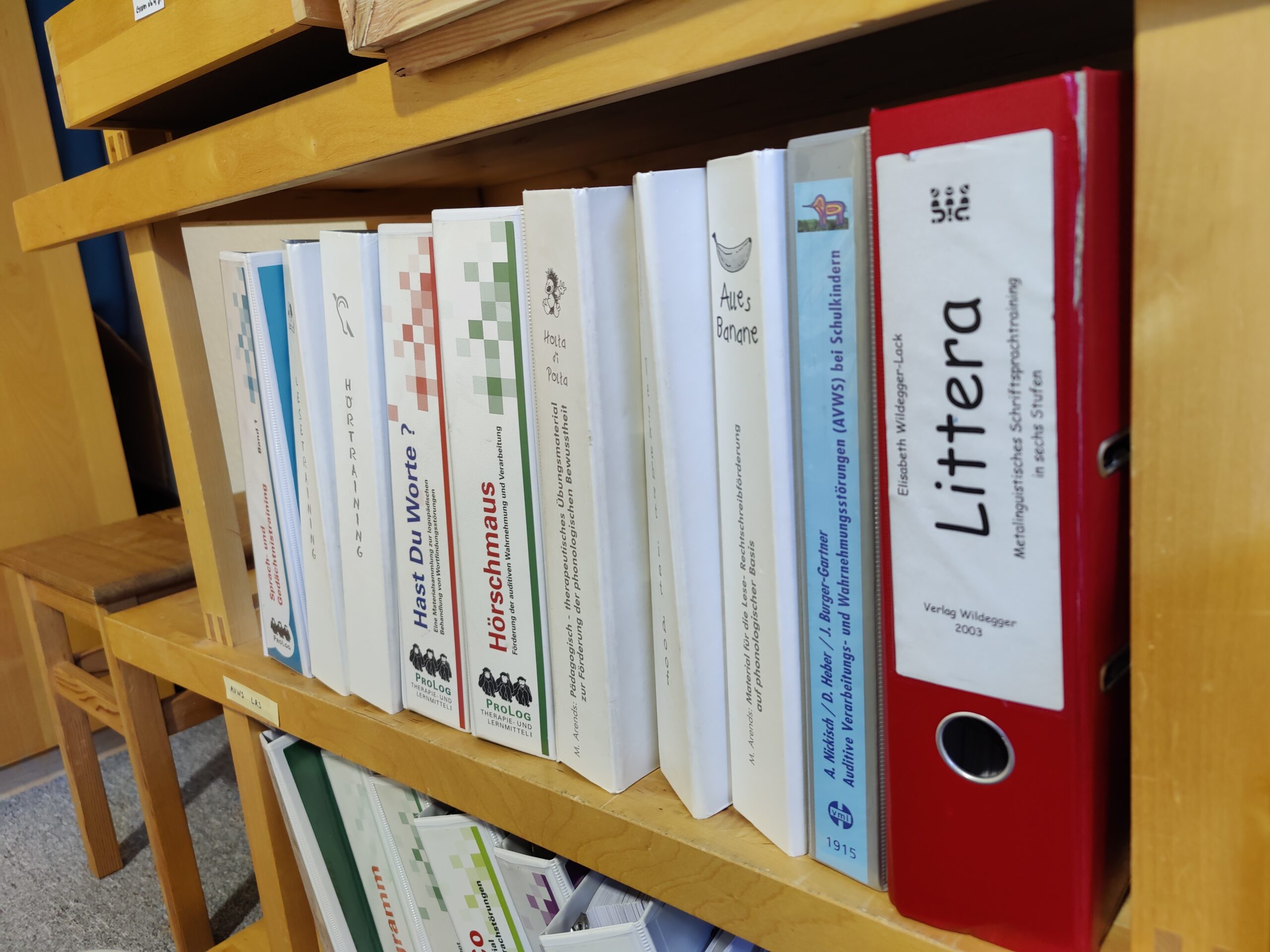
Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf!
Unser Team von kompetenten Sprachtherapeutinnen, ein individuelles Therapieprogramm, sowie eine freundliche Atmosphäre sorgen für Ihr Wohlbefinden.
